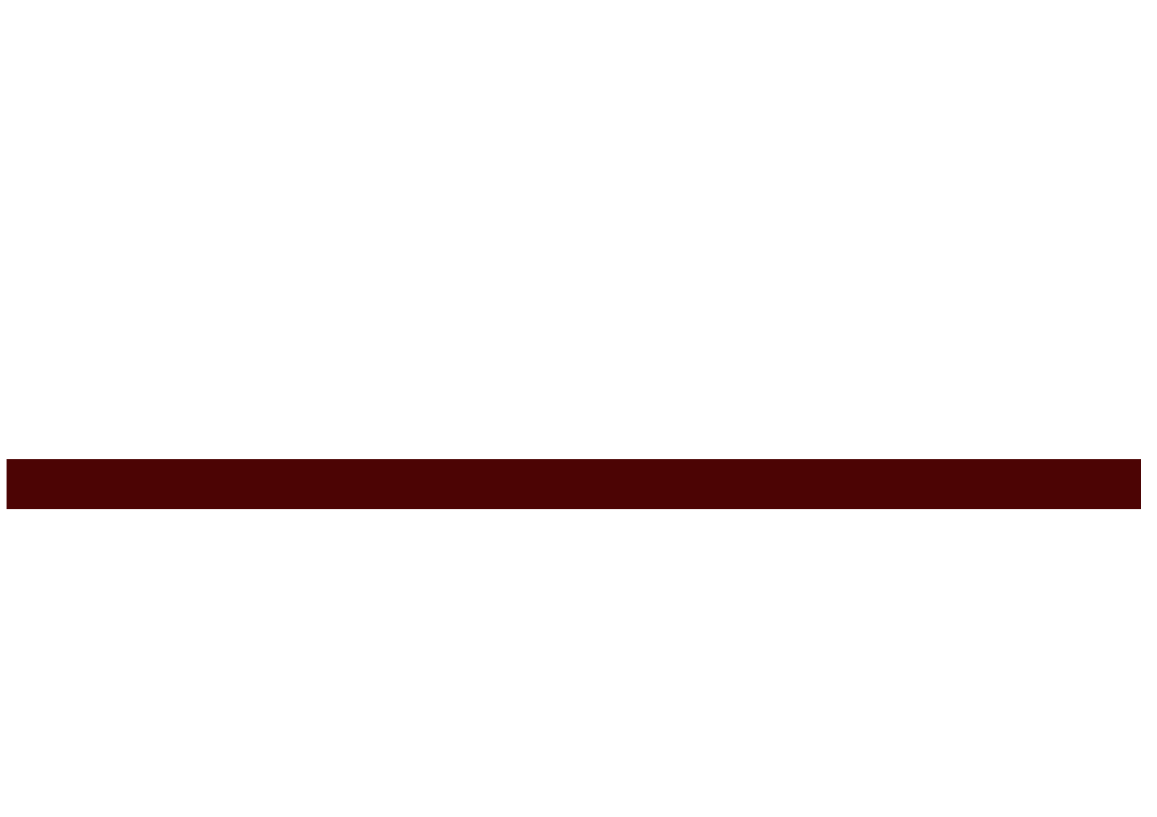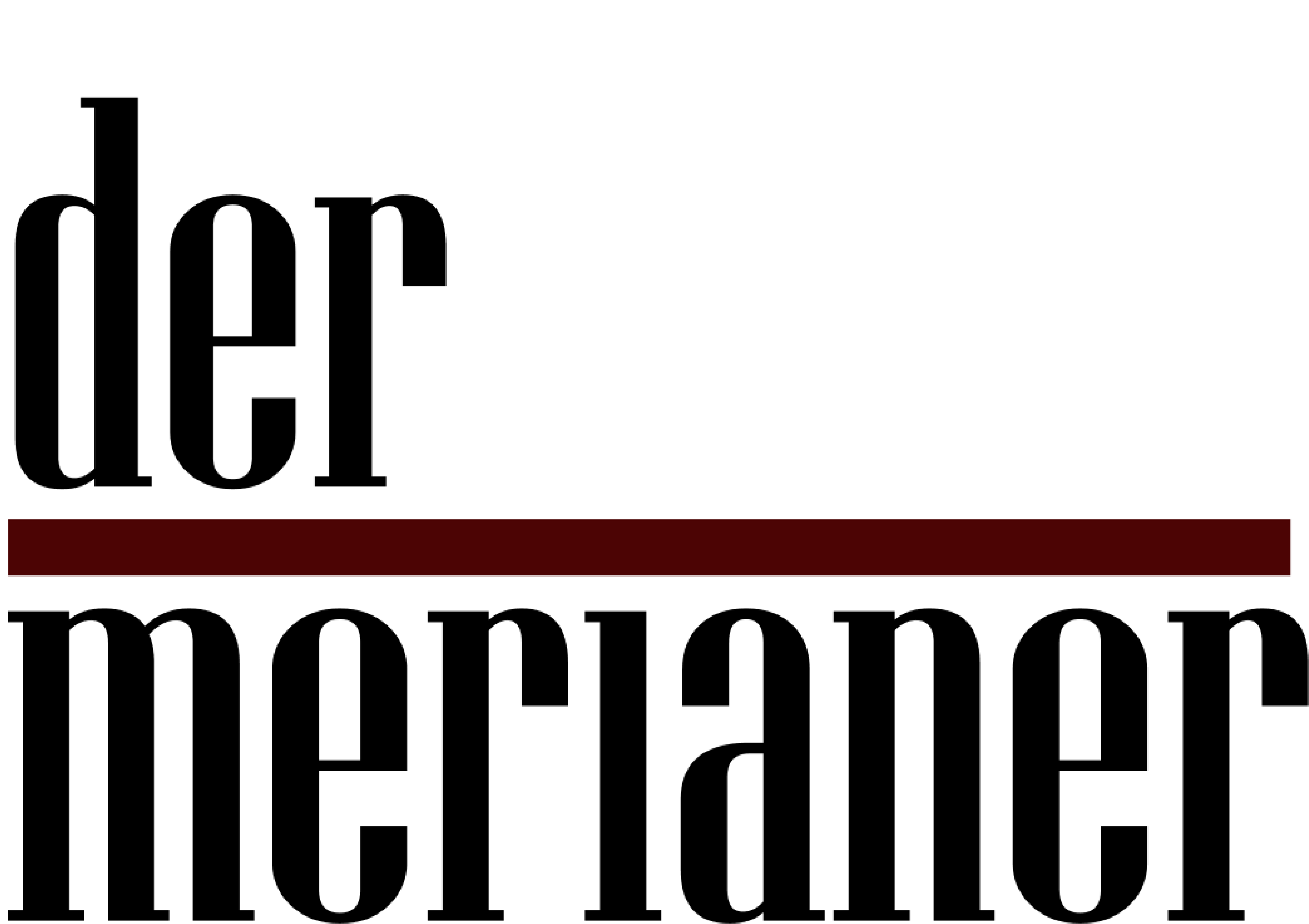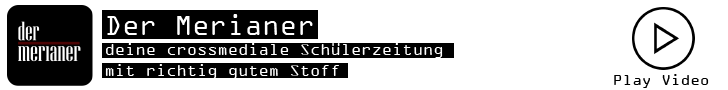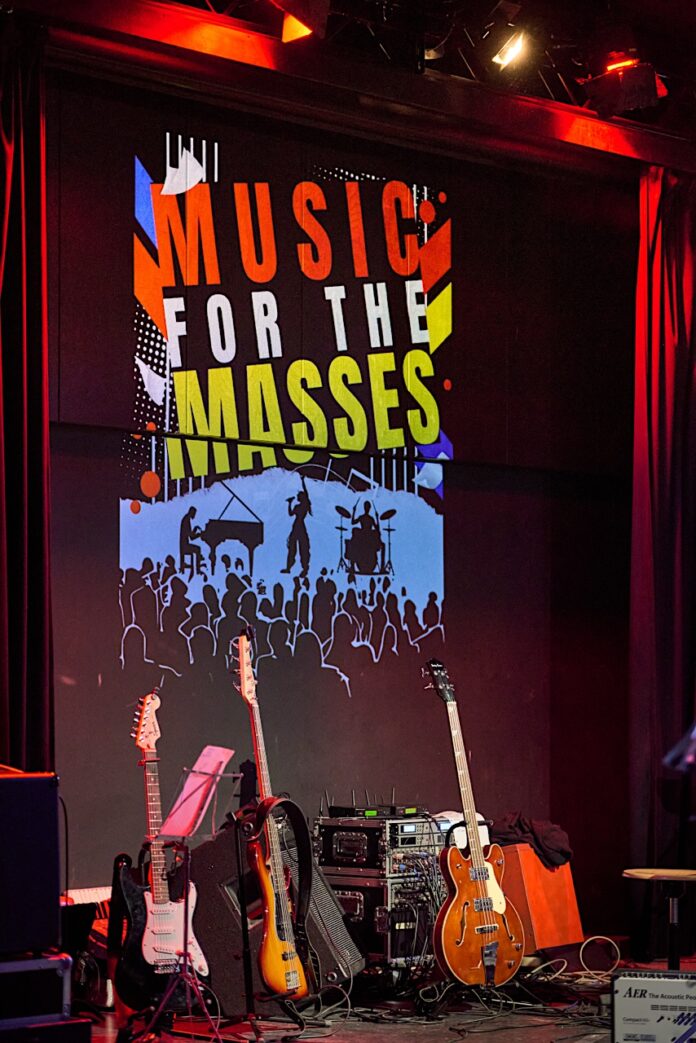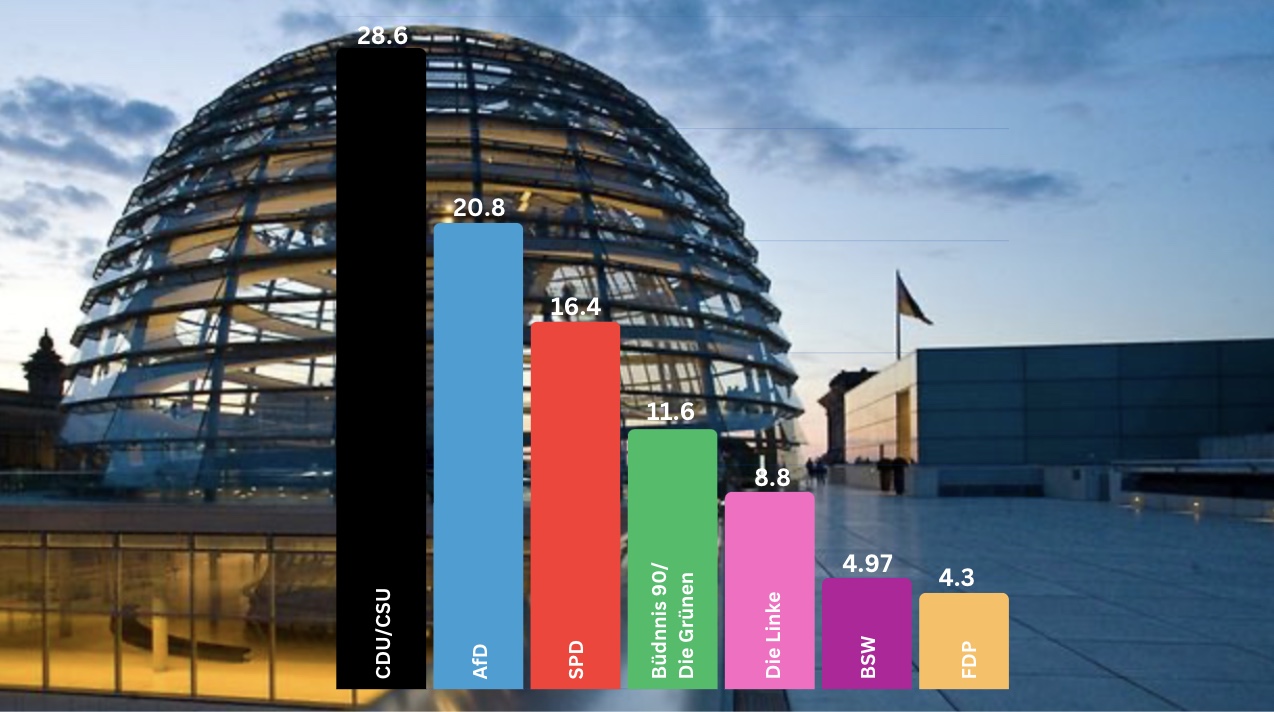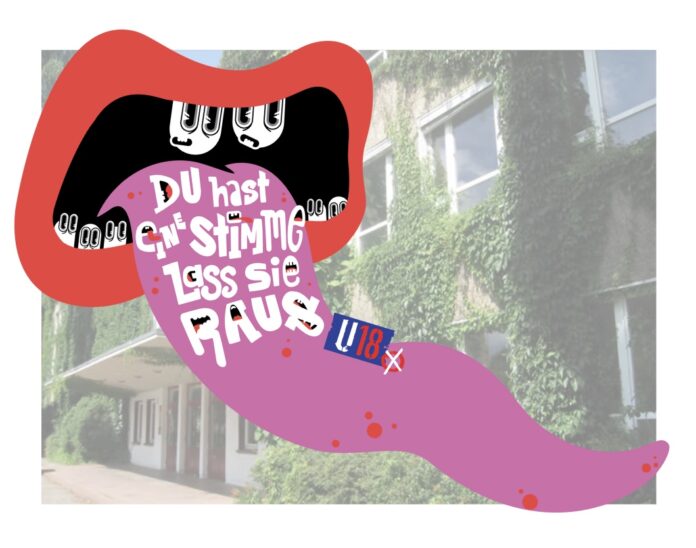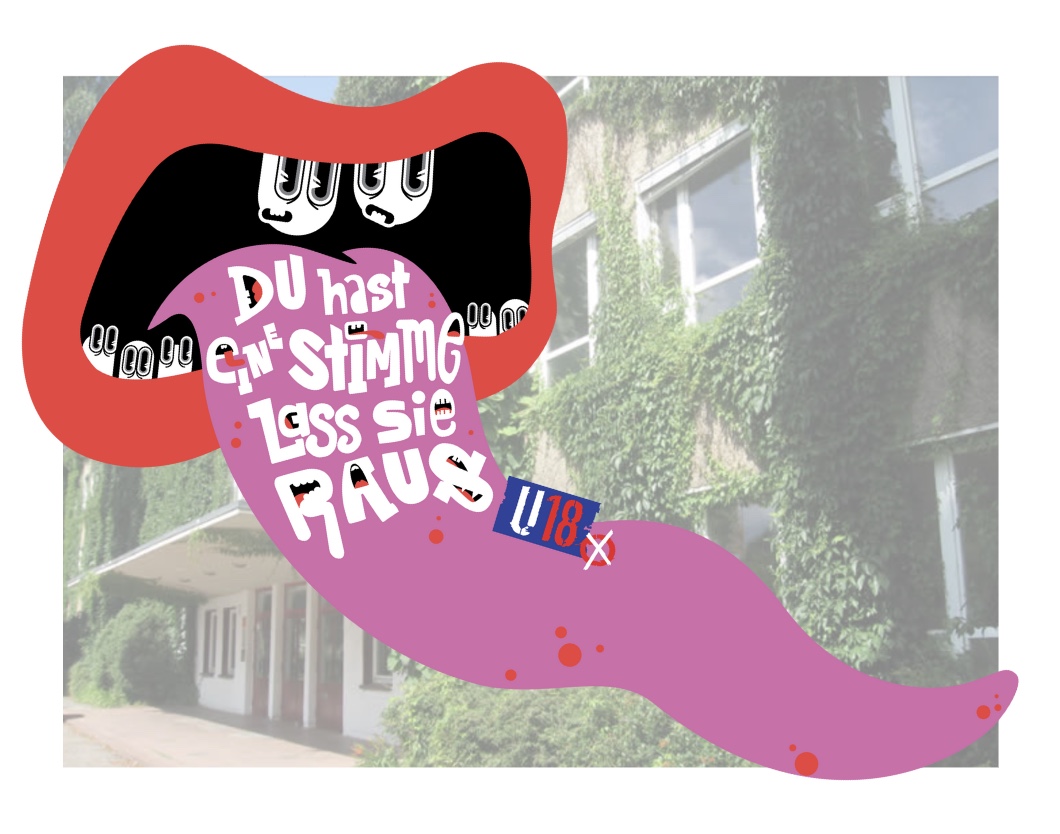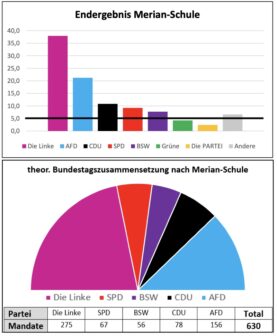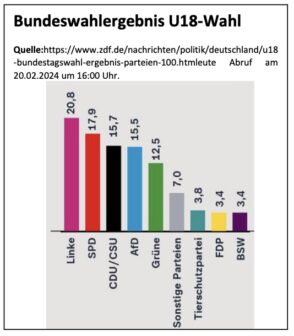Angemessen einleitende Worte zu finden, die den grauenhaften Eindrücken vom KZ-Wesen gerecht werden, ist nicht möglich. Aus diesem Grund möchte ich – im Namen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gedenkstättenfahrt ins KZ Auschwitz-Birkenau – vorrangig vom emotionalen Erleben sprechen und sehe von sachlicher Berichterstattung ab.
„Von hier müssen wir noch 20 Minuten zu Fuß laufen“, rief Frau Ambrozynski uns entgegen. Schlagartig wurde die allgemeine Heiterkeit durch bedächtiges und schweigsames Verhalten abgelöst und wir liefen los.
Uns war bereits das KZ Theresienstadt bekannt, welches wir im Rahmen der Prag-Fahrt besichtigten und hatten demzufolge eine dunkle Vorahnung, was uns bevorstand. Frau Ambrozynskis Weisung, dass wir uns alle der historischen und menschlichen Bedeutung des Ortes angemessen kleiden und verhalten sollten, stellte sich als überflüssig heraus. Jeder und jede einzelne legte von selbst eine achtungsvolle Haltung an den Tag.
Den Rundgang traten einige in Kleingruppen an, während manche – wie Sindou und ich – eine Alleinbesichtigung vorzogen. Zuerst passierten wir einen ringsum betonierten Gang mit einigen Kurven, wo uns flüsternde Stimmen einige Namen von ermordeten Häftlingen entgegenriefen. Ich persönlich befand mich inmitten einer Gruppe von Besuchern, die gleichmäßig dem Eingang zustrebte, als mich das unwohle Gefühl beschlich, Teil einer entrechteten, willenlosen Arbeitskolonne zu sein. Am Eingang angekommen, eröffnete sich uns der Blick auf Stacheldrahtzäune, Backsteingebäude und im Vorfeld platzierte Gedenktafeln. Umgehend schwangen die dunkle Vorahnung und das mulmige Bauchgefühl in blankes Entsetzen und tiefe Betroffenheit um. Die Kälte fraß sich plötzlich unerbittlich durch die wärmenden Kleidungsschichten hindurch und fuhr in Mark und Bein. Mit bedächtigem Schritt bewegten wir uns auf das schneebedeckte Barackenlager zu, ohne zu ahnen, dass es sich in unser Gedächtnis als menschliche Todesfabrik einbrennen sollte.
Als ich mir die Gedenktafeln durchlas und meinen Blick durch die Besucherströme gleiten ließ, entdeckt ich Anna mit tränengefüllten Augen und weitere zutiefst berührte Mädchen unserer Gruppe. Ob auch ich angesichts der hier begangenen Grausamkeiten den Tränen nahe sein werde? Mit gemischten Gefühlen gingen wir weiter ins Stammlager Auschwitz.
Einzig der Besuch des Konzentrationslagers vermag nicht die wahre Geschichte über das Vergangene zu vermitteln. Man muss die stummen Zeugen der Zeit – die historischen Objekte und Baulichkeiten – sowie die unbelebten Bilder nutzen, um geistig einen lebhaften Eindruck von den Geschehnissen zu gewinnen. Beispielsweise gilt es, die restaurierten Krematorien und Gaskammern auf der einen Seite und die Bilder von Menschen auf ihrem letzten Marsch auf der anderen so zusammenzusetzen, sodass man sich den genauen Ablauf vorstellen kann.
Dies dient dazu, um einerseits die Gefühlslagen der Betroffenen nachempfinden zu können und andererseits, um sich die Echtheit ins Bewusstsein zu rufen. Es fällt nämlich schwer, sich diese unvorstellbaren Grausamkeiten der KZ-Wachmannschaft und die unerträglichen Leiden der unschuldigen Häftlinge als wahre Begebenheit klarzumachen.
Im Zuge unserer Besichtigung traf jeder auf den berüchtigtsten Ort – Block 11. Die Versetzung in diesen glich einem Todesurteil und bedeutete einen qualvollen Weg des Sterbens. Vor mir verließen einige bekannte Gesichter das besagte Gebäude mit eisenharten Minen, denn sie sahen den Grausamkeitshöhepunkt, obwohl sie nie an eine Steigerung gedacht hätten. Nachdem ich die Gedenktafel studiert hatte, betrat ich Block 11 – wieder mit der oben genannten „Erinnerungs- und Empathie-Mentalität“. Allein die Vorstellung, dass Menschen dort dem Hunger- und Kältetod überlassen wurden oder mit einem großen Folterarsenal körperlich und geistig gebrochen wurden, löste größtmögliches Unbehagen aus. Unsere Gruppe empfand, was in der Nachbesprechung Anton äußerst emotionsgeladen zum Ausdruck brachte: Wie können Besucher nach der Besichtigung völlig unberührt in ausgelassene Gespräche verfallen, als befänden sie sich in einer Tourismusattraktion? Unsere Antwort lautete: Schutzmechanismus zur Verdrängung oder wirkliches (unbegreifbares) Desinteresse.
Unweigerlich drängte sich in das Betroffenheitsgefühl die Überlegung der Schuldfrage ein. Waren unsere Vorfahren aus dieser Zeit Verbrecher gewesen? Hatten sie alle die Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verantworten? Diese berechtigten Fragen sind pauschal nicht zu beantworten und bergen reichlich Polarisierungspotenzial. Dennoch bin ich der Auffassung, dass Ideologien, die – wie der Nationalsozialismus – ihre Feindbilder entmenschlichen und folglich auch ihren Vollstreckern die Menschlichkeit nehmen, zu grenzenlosen Gräueln antreiben. Diese Vollstrecker sind Täter und bewusste „Wegseher“ tragen indirekte Schuld an dem Holocaust und dem Feldzug gegen das sogenannte „Untermenschentum“.
Umso mehr mahnen die rund 1.1 Millionen Toten von Auschwitz-Birkenau zu mutigem Einsatz gegen Hass und für Völkerverständigung – oder um es in den Worten von Fritz Bauer zu sagen: „Seid Menschen“. Wenn du gerade diesen Bericht liest, dann wirst du vermutlich die hohe Opferzahl von 1.1 Millionen Menschen mit Erstaunen oder Erschrecken vernommen haben. Aber ist dir bewusst, dass jeder und jede Einzelne, von jung bis alt, auf die gleiche Weise wie du Schmerzen, Trauer und Leid empfunden hatte? Wenn man hört, dass jemand unter unmenschlichem Arbeitseinsatz vor Erschöpfung zusammenbricht, dann ist das sicherlich bemitleidenswert, aber fragt man sich nicht, wie man selbst mit diesen Qualen zurechtkommen würde?
Diese tiefgründige Frage wurde in unserer abendlichen Auswertung von jedem mit Nachdenken beantwortet. Insbesondere deshalb, weil alle an der Bildergalerie vorbeikamen, wo einige einst namenslos gemachte Menschen durch bildliche Darstellung ihre Identität wiedererlangten. Dies vermerkte Antonia in ihrem Bericht, in dem sie richtig feststellt, dass „alle Inhaftierten nicht als Mensch mit Name und Identität wahrgenommen wurden, sondern lediglich als Wesen, bei denen eine Kennzeichnung durch eine Nummer reichte.“
Mir fiel auf, dass Frauen ungefähr drei Monate und Männer sechs Monate überlebten, bevor sie auf verschiedene, aber gleichermaßen grausame Weise ihren Tod fanden.
Eine weitaus größere Beachtung verdienen die Kinder von Auschwitz, die Elina mitfühlend in ihrem Bericht erwähnt, da sie kaum zu leben gelernt hatten. Ausgestellt waren Fotos von befreiten Kindern, die teilweise auf den Armen von polnischen DRK-Helferinnen saßen und dem Leben entgegensahen. Leider gab es auch ein Bild von einem großen Bruder, der an der rechten Hand seinen kleinen Bruder und an der linken Hand seine kleine verträumt blickende Schwester führte. Alle waren definitiv unter 12 Jahre alt. Die Bildunterschrift beziehungsweise das Ziel des Weges möchte ich nicht nennen…
Ein weiteres Bild mit traurigem Ausgang zeigt ein kleines, ordentlich gekleidetes ungarisches Mädchen, das bei ihrer Ankunft in Auschwitz ängstlich und unbeteiligt dem wilden Treiben zusieht.
Weit nach dem Anbruch der Dämmerung sammelten wir uns vor dem Birkenau-Komplex, der durch zahlreiche Baracken, Gaskammern und Krematorien geprägt war. Bei beißender Kälte, wildem Schneetreiben und schneidendem Wind, warteten wir auf den Bus, der uns zurückbringen sollte. Zu diesem Zeitpunkt waren wir innerlich tief beeindruckt und gerührt. Dem einen mag die Kälte, dem anderen eine Unterhaltung von den Tageseindrücken abgelenkt haben. Ich stand einsam vor dem Lagertor, als mir auffiel, dass der Komplex nach hinten hinaus von einem weiten Wald umgeben war. Das bedeutet, dass die Inhaftierten von der Freiheit lediglich wenige Meter getrennt waren; leider bestanden diese „wenigen Meter“ aus Stacheldrahtzäunen mit bewaffneten Wachposten und dahinterliegenden Wiesen.
Hierbei kam mir ein interessanter Gedanke in den Sinn: Vor 80 Jahren haben die Häftlinge denselben Mond und dieselben Bäume des Waldes gesehen. Dem einen mag dies als geistiger Überlebensanker gedient haben.
Ich kann nur einige Impressionen mit den verbundenen Gedanken- und Gefühlsgängen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz-Birkenau detailliert ausführen und weiß, dass jeder und jede andere noch ganz andere Sichtweisen auf das Erlebte beschreiben könnte. Dennoch hoffe ich, dass mein Bericht dem Leser einen nachvollziehbaren Einblick in unsere Reise gegeben hat und ihn ermutigt, selbst diese wertvolle Erfahrung zu machen.
Letztlich danke ich im Namen aller Frau Ambrozynski und Herrn Acker für die Organisation und Betreuung unserer Gedenkstättenfahrt.
„Die Toten mahnen uns.“ – Samuels Appell
i.A. Redaktion Philipp Peter, am 18.01.2025